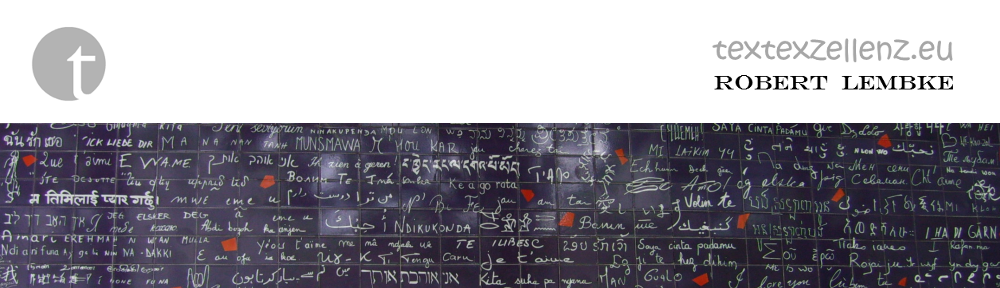Es war am letzten Mittwochabend, als die Bayern den FC Arsenal auswärts mit 2:0 schlugen. Der ostdeutsche, von den Feuilletons gefeierte Schriftsteller Clemens Meyer gab sich in der Bibliothek des Literaturhauses die Ehre, und er machte seine Sache gut. Unverkennbar das sächsische Lokalkolorit in Sprache und Habitus, war er gekommen, um nicht nur seinen neuen Roman „Im Stein“, sondern auch sich selbst ein bisschen vorzustellen.
Ihm zur Seite saß Knut Cordsen, leidlich distinguierter Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks, und gab sich alle Mühe, von Meyers spontanen, seltsam widerwilligen Ausbrüchen nicht an die Wand gedrückt zu werden. Beide machten ihre Sache gut, und so wurde es ein recht vergnüglicher Abend, wozu nicht zuletzt Meyers launische Sprüche beitrugen. Fast gleich zu Beginn fuhr er seinen Sidekick an: „Machen wir erstmal einen Grundkurs Literatur!“, um wenig später schuldbewusst zu bemerken: „Immerhin bin ich ja drei Minuten lang ruhig geblieben.“ Cordsen hatte da gerade einmal zu viel nachgefragt, warum sich Meyer in seinem gewichtigen neuen Roman „Im Stein“ den eher abgründigen Seiten der Gesellschaft und des Lebens zuwende und was es mit seiner Vorliebe für Pferderennen auf sich habe.
Nach weiteren Erkundungen des etwas beflissen wirkenden Cordsen in Richtung Privatleben des Schriftstellers – unvermeidlicherweise kam dabei auch die Gefängniserfahrung des Autors zur Sprache – las Meyer ein erstes Stück aus seinem neuen Roman. Für mich der Höhepunkt des Abends, denn jener seitenlange innere Monolog einer Prostituierten, die irgendwo in Hannover oder Wolfsburg auf den nächsten Freier wartet und dabei an ihre Mutter, die richtigen Kosmetika, eine „Kollegin“ und vor allem ihre Vergangenheit denkt, war nicht nur brillant geschrieben (wohl zurecht erinnerte Cordsen hier an James Joyce) , sondern traf sich mit meiner eigenen Erinnerung. Denn die Hure, wie man laut Meyer sagen darf, Hure ist in Ordnung, Nutte dagegen niemals, stammte aus Jena, wo ich acht Jahre gelebt habe, sie dachte intensiv zurück an Landschaft und Leute, und dann war da noch der Satz: „von wegen Jena-Paradies“, aus dem sie zugunsten eines prekären westdeutschen Daseins als Sexarbeiterin, wie das jetzt in PC-Deutsch heißt, vertrieben wurde.
Je länger der Abend dauerte, desto lebendiger und dominanter wurde Meyer. Dank seiner Launigkeit und dem zur Schau getragenen Unwillen dem bildungsbürgerlichen Literaturbetrieb gegenüber hatte er das Publikum früh auf seine Seite gebracht. Nur gegen Ende, als die Rede auf sein Dozentenengagement am Leipziger Literaturinstitut kam, wo einst seine Karriere als Schriftsteller begonnen hatte, wurde er fast ein bisschen arrogant.
Cordsen lieferte seinen vielleicht besten Beitrag mit einem zum Thema passenden Zitat von Dorothy Parker: „You can lead a whore to culture but you can’t make her think.“ Noch beeindruckender ist der Satz, wenn man die Entstehung kennt: Miss Parker sollte wohl in einem Interview einen Satz mit „horticulture“ (Gartenbau) bilden und zog sich mit Assonanz und Tiefsinn offenbar blendend aus der Affäre.
Und wo wir gerade beim Thema Entstehungsgeschichte sind: Clemens Meyer ließ sich beim Titeln in die Karten schauen und offenbarte den Ursprung von „Im Stein“. Er geht zurück auf ein österreichisches Idiom, das er falsch verstanden habe: „In den Stein gehen“ bedeute in den Knast gehen, weil es wohl irgendwo in Österreich ein berühmtes Gefängnis bei einer Ortschaft namens Stein gebe. Der Stein sei aber als Allegorie auf die Stadt Leipzig und ihr „Rotlichtmilieu“ zu verstehen, ein Ausdruck, gegen den sich Meyer nach längerer Überlegung ausdrücklich nicht verwahrte mit dem Argument, es komme ja nicht auf die Bezeichnung, sondern auf das richtige Verständnis der Sache an.
Alles in allem ein Abend, der Lust auf das Buch machte und seinen Verfasser als von Authentizität durchtränkten, ehrlichen Arbeiter am Text vorstellte, der sich über Alice Schwarzers Werbung für die Bild-Zeitung furchtbar aufregte und die Gebundenheit des wirklichen Schriftstellers (Vorbild: Wolfgang Hilbig) an einen Ort herausstrich. Für alle, die da waren, sicher ein reinigendes Gewitter zur rechten Zeit nach Florian Kesslers Thesen in der ZEIT und der Debatte über den leidigen Konformismus und die Milieuverlorenheit der deutschen Gegenwartsliteratur.
Lesen Sie Clemens Meyer, er ist kein Arztsohn!