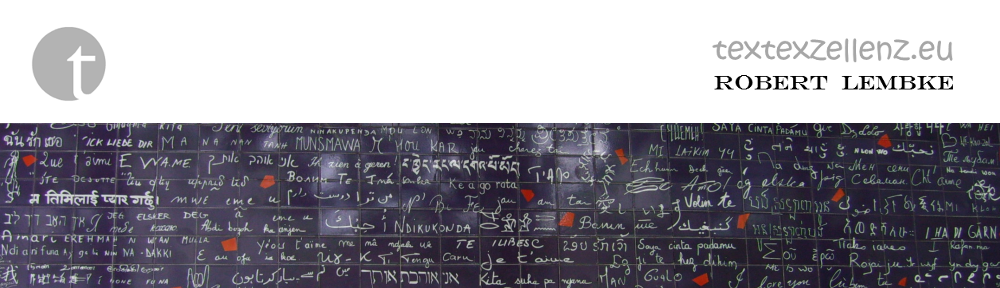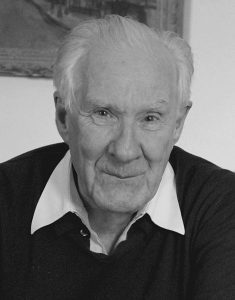Besprechung von: Karen Gloy, Wahrheit und Lüge, Würzburg: Königshausen & Neumann 2019, 240 S., 24,80 €
Die Frage nach der Wahrheit gehört zu den traditionellen, aber auch traditionell schwierigsten Fragen der Philosophie. Nicht wenige identifizieren sie mit dem philosophischen Tun als solchem – als unablässige Suche nach Wahrheit, die kaum je an ein Ziel gelangt –, und der sprichwörtliche ‚Skandal der Philosophie‘ gibt der Enttäuschung darüber Ausdruck, dass all die Anstrengungen des menschlichen Geistes doch nie zu einer allgemein anerkannten Wahrheit geführt haben.

Karen Gloy unternimmt in ihrem zunächst unscheinbar wirkenden Buch den Versuch, Licht ins Dunkel dieser alten Frage zu bringen, und sie greift dabei auf eine Vielzahl von Denkansätzen und wissenschaftlichen Disziplinen sowie nicht zuletzt eigene ethnologische Feldforschung zurück. Die titelgebenden Begriffe Wahrheit und Lüge – eine Reminiszenz an Nietzsches Schrift Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne – fasst sie dabei recht weit als Verhalten auf, nicht im engen Sinne als Aussagen bzw. Eigenschaften von Aussagen. Daher fallen darunter nicht nur Sprechakte, sondern alle möglichen Verhaltensweisen, wie sie etwa auch bei Tieren vorkommen (Mimikry, Täuschung etc.).
Gloy betont durchgängig die Relativität von Wahrheit und Lüge, und das in (mindestens) dreifacher Hinsicht, ohne dass diese Zugänge – und das ist der erste Kritikpunkt – im Buch klar expliziert und geschieden wären: Erstens stellen Wahrheit und insbesondere Täuschung und Lüge im evolutionstheoretisch-naturalistischen Sinne Verhaltensweisen dar, die „der Durchsetzung und Lebensbewältigung“ (75) dienen und beim Menschen zwar besondere Formen annehmen (etwa die der Intrige oder der bewussten Leugnung von Fakten), prinzipiell jedoch in der Evolution vorgebildet seien. Eine Verurteilung falscher bzw. lügenhafter Aussagen und Verhaltensweisen, wie sie etwa in Platons Abwertung der Kunst als ‚Schein des Scheins‘ zum Ausdruck kommt, wird (mit Nietzsche) als einseitig und widernatürlich abgelehnt.
Haben Pragmatismus und postmoderner Relativismus das letzte Wort?
Darüber legt sich eine zweite, sozialpsychologische Ebene, wonach Wahrheit und Lüge als gleichberechtigte Verhaltensweisen bewertet werden können anhand der Alternative prosozial-antisozial. So wird etwa Donald Trump für seine Radikalisierung der politischen Kommunikation – d.h. ihrer fast völligen Entkoppelung von realen Sachverhalten – auch von Gloy kritisiert, weil er so die Grundlagen des Zusammenlebens untergräbt. Auf der anderen Seite nimmt sie die archaischen Riten und Praktiken von Naturvölkern in Schutz – als alternative Form der Welterschließung –, da diese den Zusammenhalt der Gruppe stärken bzw. ihn überhaupt erst konstituieren.
Auf einer dritten, der linguistisch-sprachphilosophischen Ebene, wird dem Problem der Vermittlung von Sprache und Welt ausführlich nachgegangen. Dabei zeigt sich eine vom weltgeschichtlichen Triumph der westlichen Zivilisation verdeckte Pluralität von Zugangsweisen zur Welt und daraus resultierenden kulturellen Verschiedenheiten, die es laut Gloy zu achten und zu bewahren gelte: So spiegelten etwa Indiosprachen durch ihre Betonung der Konkretion und des je aktuellen Geschehens eine ganz andere Weltanschauung als die westliche, zur Abstraktion und zu Substantivierungen neigende: „Der zweifellos technischen Überlegenheit der naturwissenschaftlich geprägten Kultur steht die größere Sinnlichkeit und Sensibilität von Naturethnien gegenüber, die die Zivilisation verloren hat.“ (41)
Ebenso interessant und aufschlussreich ist die historische Untersuchung der Begriffe Wahrheit und Falschheit bzw. Lüge, die sich im zweiten Kapitel findet. So leite sich Wahrheit zunächst von einer möglichst objektiven und genauen Wiedergabe eines Geschehens ab – sozusagen einem Augenzeugenbericht –, wie sich noch im deutschen Wort „Wahrnehmung“ erhalten hat und wofür einige Sprachen sogar eine eigene grammatische Form ausgebildet haben (den sogenannten Inferentialis). Die Verpflichtung auf Wahrheit und ihre Privilegierung gegenüber der Falschaussage erwächst laut Gloy aus der Notwendigkeit gesellschaftlicher Organisation, die zunehmend komplexer wird und daher die Verlässlichkeit von Aussagen, Absprachen, Verträgen usw. erfordert. Vor allem unwahre oder fingierte Anklagen vor Gericht scheinen im Altertum ein riesiges Problem gewesen zu sein; ein Widerschein dessen findet sich noch im 8. Gebot der Bibel: „Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten.“
Ausgehend von dort kommt es – laut Gloy unter anderem ausgelöst durch die Erkenntnis von Sinnestäuschungen – zur folgenreichen Unterscheidung von Sein und Schein und damit jener Verschiebung im Wahrheitsverständnis, die den abendländischen Sonderweg ausmacht und bis heute prägt. Gloy zeichnet diesen unter anderem bei Platon gut nachvollziehbar nach, geht dann mit Nietzsche, Heidegger und dem linguistic turn die nächsten Schritte hin zum (post)modernen Relativismus und landet schließlich bei einem – auch evolutionstheoretisch und ethnologisch informierten – Standpunkt-Perspektivismus, der m.E. viel mit dem Pragmatismus gemein hat: „Alles, was sich erreichen lässt, ist die Wahrheit einer Gruppe oder eines Kulturkreises, welche Interessensgemeinschaften mit bestimmten Anliegen bilden und sich von anderen unterscheiden.“ (53)
Wie viel Wahrheit ist möglich angesichts von Sprach- und Denkgewohnheiten?
Demgegenüber wird „echte“ „Wahrheit im eigentlichen Sinne“ nur an einer Stelle überhaupt thematisiert und – im Geiste des Buches durchaus konsequent – auf eine (bloße?) „Glaubensangelegenheit“ (45) reduziert. Die Untersuchung gipfelt schließlich in einer anspruchsvollen Diskussion von Theorien zum Verhältnis von Sprache und Welt, in der Gloy eine vermittelnde Position zwischen dem Sprachrealismus des frühen Wittgenstein und dem radikalen Idealismus von Derrida zu beziehen versucht. Diese wird freilich, wie leider vieles in diesem Buch, mehr angedeutet als ausgeführt.
Damit sind wir bereits bei den Kritikpunkten. Karen Gloy hat ein anregendes, disparateste Theorien miteinander ins Gespräch bringendes Buch geschrieben – dem übrigens ein Lektorat gut getan hätte angesichts der vielen formalen und inhaltlichen Fehler –, eine Art postmoderne tour de force zur urphilosophischen Wahrheitsfrage. Anders als das akademisch wirkende Inhaltsverzeichnis jedoch suggeriert, haben wir es eher mit einer kommentierten Materialsammlung als einer stringenten Argumentation zu tun – beispielsweise wird immer wieder seitenlang Literatur referiert, ohne dass der Bezug zu den Thesen und Argumenten der Autorin klar ist. Oder haben wir es hier mit einem Gloy unfreiwillig unterlaufenden Rück-Übergang von der hypotaktischen (überordnenden, hierarchischen) zur parataktischen (nebenordnenden, aufzählenden) Denkform zu tun, um eine ihrer zentralen Differenzierungen auf das Buch selbst anzuwenden?
Ebenso gut könnte man die Verabschiedung eines emphatischen Wahrheitsverständnisses zugunsten der Differenz prosozial-antisozial als spezifisch weiblichen Zugriff auf die gesamte Fragestellung ansehen, der Erkenntnisprobleme den vermeintlichen Notwendigkeiten sozialen Miteinanders unterordnet – ein Indiz hierfür wäre die über das Buch verteilte, häufige Betonung der Berechtigung von Höflichkeitslügen sowie der gebotenen Beachtung von gesellschaftlichen Konventionen. (Dies nur um zu illustrieren, in welche Schwierigkeiten man gerät, wenn durch einen grundsätzlichen Relativismus sämtliche Wertmaßstäbe als kontingent erscheinen.) Einen weiteren blinden Fleck des Buches bildet die fast völlige Ausblendung von Herrschaftsfragen. Dass die abendländische Zivilisation am Ende eines todbringenden Siegeszugs mehr und mehr in sich geht, der eigenen Eindimensionalität überdrüssig wird und lapidar feststellt, ihre vielen Opfer hätten doch auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung gehabt – ist das nicht auch eine Art philosophische Bankrotterklärung? Zwar gibt es immer wieder interessante Ansätze einer Kritik realer Verhältnisse – etwa wenn Gloy die mediale Übermacht kenntlich macht oder sich im Detail mit dem Vorwurf der „Lügenpresse“ (vgl. S. 189ff.) auseinandersetzt –, die Beobachtungen und Urteile fügen sich jedoch nicht zu einem Gesamtbild und wirken daher okkasionell und letztlich subjektiv. Wie könnte es jedoch angesichts des vertretenen relativistischen Standpunkts anders sein?